Gegenwärtige Fellows
José Marcos Macedo
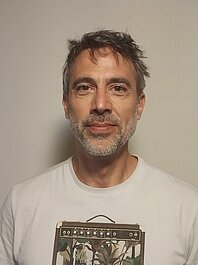
José Marcos Macedo ist Professor für griechische Sprache und Literatur an der Universität von São Paulo (Brasilien). Seine Forschungsschwerpunkte sind die griechische religiöse Sprache, die griechische Linguistik sowie die indogermanische Dichtung und Phraseologie. Im Rahmen des MagEIA-Projekts erstellt er ein kommentiertes Lexikon der göttlichen Epitheta, die in den griechischen magischen Papyri zu finden sind, und stellt Querverweise zu anderen relevanten Epitheta aus epigraphischen, lexikographischen und literarischen Quellen bis zum 4./5. Jahrhundert n.Chr. her. Das Lexikon wird auch „onomastische Sequenzen“ enthalten, die Partizipien und Relativsätze sowie phraseologische Parallelen (sowohl innerhalb der magischen Papyri als auch darüber hinaus), Formeln und syntagmatische Epitheta-Ketten umfassen. Die Anhänge des Lexikons bieten unter anderem eine Liste zusammengesetzter Epitheta, geordnet nach ihren ersten und zweiten Elementen, einen semantischen Index und eine eingehende Analyse der Wortbildung in zusammengesetzten Wörtern.
Gideon Bohak

Gideon Bohak ist Professor am Department für jüdische Philosophie und Talmud der Universität Tel Aviv. Er ist ein weltweit führender Experte für jüdische Magie, insbesondere im Altertum und Mittelalter; in zahlreichen Beiträgen hat er zur Erforschung der Texte der Kairoer Geniza beigetragen. Er ist der Autor des Standardwerks Ancient Jewish Magic. A History (2008).
Bill Rebiger
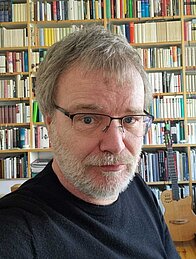
Bill Rebiger ist Judaist mit besonderem Schwerpunkt auf jüdischer Magie und Kabbala. Er hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht, darunter auch Editionen von zwei herausragenden Werken der jüdischen Magie: Sefer Shimmush Tehillim oder „Buch der magischen Verwendung der Psalmen“ und Sefer ha-Razim oder „Das Buch der Geheimnisse“. In seinem MagEIA-Projekt möchte er eine Theorie performativer haptischer Akte für das Phänomen der magisch-rituellen Heilung durch die körperliche Berührung eines Wunderheilers oder einer anderen charismatischen Persönlichkeit, wie es in spätantiken jüdischen und christlichen Texten belegt ist, entwickeln.
Hrach Martirosyan

Hrach Martirosyan wurde 1964, am 10. November, in Kirovakan (heute Vanadzor), Armenien, geboren. Nach seinem Abschluss am Pädagogischen Institut von Vanadzor, wo er armenische Sprache und Literatur studierte (1986-1991), arbeitete er am Institut für Archäologie und Ethnographie der Armenischen Akademie der Wissenschaften in Eriwan als Forscher unter der Leitung von Prof. Dr. Sargis Harutyunyan (1991-1994). Im Jahr 2001 wurde Dr. Martirosyan in das PhD-Programm der Universität Leiden aufgenommen (Promotor: Prof. J. Weitenberg; Projekt „Indo-European Etymological Dictionary“ unter der Leitung von Prof. Lubotsky). Die Dissertation wurde am 13. Februar 2008 an der Universität Leiden erfolgreich verteidigt. Die überarbeitete und ergänzte Fassung wurde bei Brill in Leiden veröffentlicht („Etymological dictionary of the Armenian inherited lexicon“, 2010, ca. 1000 Seiten).
Martirosyan war Forscher oder Gastdozent in Leiden, Michigan, Eriwan, Vanadzor, Oxford, Pavia, Moskau, Hokkaido und anderswo. Von 2015 Februar bis 2017 März hatte er eine Postdoc-Stelle am Institut für Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien (Projektleiter: Velizar Sadovski; daraus resultierendes Buch: „Iranian personal names in Armenian collateral tradition“. Iranisches Personennamenbuch V/3, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2021). Seit 2019 September war er Dozent für modernes Ostarmenisch und klassisches Armenisch an der UCLA (University of California, Los Angeles). Von 2021 November bis 2023 Juli war er Alexander von Humboldt-Senior-Forschungsstipendiat an der Turfanforschung: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Forschung zu iranischen Lehnwörtern im Armenischen).
Seit 2022 Dezember leitet Martirosyan das Projekt „The Armenian language, land, and culture in the context of the Armenian Highlands“ im Rahmen des Call for Remote Laboratories Fellowship Programme: Armenien, initiiert vom Wissenschaftsausschuss der RA. Er führt einen Online-Kurs und ein Forschungsprojekt über die Geschichte der armenischen Sprache an der „Hayerenagitut'yan akademia“ durch.
In seinem MagEIA-Projekt wird Hrach Martirosyan den armenischen Wortschatz im Zusammenhang mit dem semantischen Bereich „Magie“ untersuchen, der magische Kunst und Praktiken, Hexerei, Zaubersprüche und Beschwörungen umfasst.
Mersha Alehegne Mengistie

Mersha Mengistie ist Äthiopistikwissenschaftler, Philologe, Literaturwissenschaftler und Kulturaktivist. Seit Juni 2018 ist er außerordentlicher Professor für Philologie in der Abteilung für Linguistik und Philologie an der Universität Addis Abeba. Er begann seine Laufbahn 1995 mit einem Lehrdiplom des Kotebe College of Teacher Education und unterrichtete zwei Jahre lang an einer Sekundarschule, bevor er sein Studium an der Universität Addis Abeba fortsetzte.
Er hat einen B.A. in Äthiopischer Sprache und Literatur (1997) und einen M.A. in Literatur (Fremdsprachen) (2003), beide von der Universität Addis Abeba, sowie einen Ph.D. in Äthiopistik und Philologie (2010) von der Universität Hamburg, Deutschland. Außerdem schloss er 2023 einen Master in Sozialarbeit an der Universität Addis Abeba ab. Sein Promotionsstudium wurde durch ein DAAD-Stipendium unterstützt.
Während seines Sabbaticals und in den Folgejahren (2018-2021) erhielt Mengistie ein Stipendium der Alexander-Humboldt-Stiftung, wo er an einem Projekt mit dem Titel „Parchment Saints: Life and Afterlife of Ethiopian Saints from Parchment to Paper“ (Leben und Nachleben äthiopischer Heiliger vom Pergament zum Papier) arbeitete, das derzeit bei Brill im Druck ist. Im Anschluss an sein Stipendium erhielt er ein Forschungsstipendium für das Projekt „Documenting Ancient Education Systems in Africa: Abennat Temhert in Äthiopien“, das von der Gerda Henkel Stiftung finanziert wird. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts ist er Co-Betreuer von drei Doktoranden, die ihre Promotionsprojekte zu den Themen des Projekts entwickeln. Darüber hinaus betreut er mehrere andere Initiativen in ganz Äthiopien.
Frank Simons

Frank Simons ist Postdoktorand am Trinity College Dublin und arbeitet an einem Projekt zur mesopotamischen Psychiatrie. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Magie und Weissagung in Mesopotamien, insbesondere auf der Rekonstruktion und Poetik antiker Texte. Er interessiert sich auch für die realia der antiken Welt und hat kürzlich Arbeiten zur Identifizierung von Tieren und Krankheiten in Keilschrifttexten veröffentlicht.
Im Rahmen von MagEIA bereitet er eine kritische Ausgabe der Ritual- und Beschwörungsserie Šurpu 'Burning' vor – ein 1200 Zeilen langer Text, in dem eine umfangreiche Zeremonie beschrieben wird, mit der ein Leidender von einem göttlichen Fluch befreit werden soll.
Paola Dardano

Paola Dardanos Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft, insbesondere der hethitischen und griechischen Sprache. Ihre Interessen umfassen die Morphosyntax und die Phraseologie der indogermanischen Sprachen, die Theorie und Methoden der Etymologie, die indogermanische Dichtersprache, die Kontaktlinguistik. Von 2008-2009 war sie Forschungsstipendiatin der Alexander von Humboldt-Stiftung an der Universität zu Köln. Seit Dezember 2019 ist sie ordentliche Professorin an der Università per Stranieri di Siena. In ihrem MagEIA-Projekt wird sie die Terminologie und Phraseologie der hethitischen magischen Texte untersuchen.






