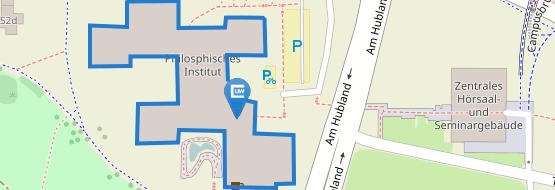Programm

Hier finden Sie das Tagungsprogramm vom 9.10. - 11.10.
Die Raumplanung ist vorläufig. Die finalisierten Raumangaben finden Sie ab dem 23. September 2024 auf dieser Seite.
Mittwoch, 9.10.2024
ab 12 Uhr
Bittel melden Sie sich im Konferenzbüro an. Dort bekommen Sie auch Ihr Namensschild.
Raum: Übungsraum 7
In ihrer digitalen Tagungsmappe finden Sie:
13-14 Uhr
- Begrüßung durch den Dekan der Philosophischen Fakultät Prof. Dr. Thomas Baier
- Begrüßung durch die Vorsitzende der DGEKW Prof. Dr. Gertraud Koch
- Begrüßung durch den Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Empirische Kulturwissenschaft, Würzburg
- Prof. Dr. Michaela Fenske
- Jun.-Prof. Dr. Laura Otto und PD Dr. Sebastian Dümling
Raum: Hörsaal 2
14-16 Uhr
- Dr. Helen Ahner (Berlin)
- Dr. Valeska Flor (Tübingen)
- Julian Schmitzberger, M.A. (Zürich)
- Dr. Katharina Schuchardt (Dresden)
Raum: Übungsraum 9
Akademische Stellenprofile abseits der Professur werden in der Regel unter dem Label „wissenschaftlicher Nachwuchs“ zusammengefasst. Die Kategorie umfasst damit nicht nur angehende Wissenschaftler:innen und jene, die sich erst am Anfang ihrer Laufbahn befinden – wie Studierende und Promovierende –, sondern auch Post-Docs, akademische Ratsstellen, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen in Forschungsprojekten, Juniorprofessor:innen und Privatdozierende. Das Konstrukt der „Qualifikationsphase“ verschleiert allerdings, dass ein wesentlicher Teil der akademischen Wissensproduktion und Lehrtätigkeit von diesen Statusgruppen geleistet wird. Wissenschaftler:innen, insbesondere jene ohne Dauerstellen, stehen vor einer widersprüchlichen Situation: Obwohl viele bereits über umfangreiche Qualifikationen verfügen, wird ihre fachliche Anerkennung oftmals von noch ausstehenden Leistungen abhängig gemacht, was sich in der Befristungspraxis des Hochschulwesens widerspiegelt. „Etwas erreicht“ hat man erst, wenn man sich in einem Berufungsverfahren behaupten konnte und den Beruf Wissenschaftler:in auch selbstbestimmt ausüben kann. Dass dies bereits gelebte Praxis sein kann, zeigt der Blick auf Universitätssysteme in anderen Ländern: Wissenschaftliche Arbeit muss nicht immer darauf ausgerichtet sein, eine Führungsposition einzunehmen (Lecturer/Researcher). Wir laden Interessierte aus allen Statusgruppen dazu ein, diese Themen zu diskutieren und Ideen zu entwickeln. Angesprochen sind nicht nur Promovierende und Post-Docs, sondern explizit auch (Junior)Professor:innen. Gemeinsam wollen wir Handlungspotentiale ermitteln und die Impulse und Ergebnisse des Austauschs innerhalb von Arbeitskreisen weiterverfolgen. Wo stehen wir als „Fach“? Und wo wollen wir hin? Was für institutionelle Veränderungen sind notwendig, um die Anerkennung von wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen in Forschung und Lehre (dem klassischen Mittelbau) zu fördern? Müssen wir unsere Bewertungsstandards und -verfahren überdenken, um der Qualifikation von wissenschaftlichem Personal jenseits der Professur gerecht zu werden? Wie kann die Kategorie „Nachwuchs“ neu gedacht werden? Welche Formen der Betreuung und Kooperation (wie z. B. Mentoringnetzwerke) sind abseits verbesserter struktureller Rahmenbedingungen erforderlich, um eine Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ über die Grenzen von Statusgruppen hinweg zu ermöglichen?
- für den Ständigen Ausschuss für Forschungsdaten und Forschungsethik der DGEKW:
- Dr. Sabine Imeri (Berlin)
- JProf. Dr. Mirko Uhlig (Mainz)
- Ass.-Prof. PD Dr. Marion Näser-Lather (Innsbruck)
- für den Programmpunkt KI in der Lehre:
- Dr. Anna Weichselbraun (Wien)
- Dr. Libuse Veprek (Tübingen)
Raum: Übungsraum 22
Quer zu spezifischen Themen sind Forschende der EKW zunehmend mit Fragen zum Umgang mit Forschungsdaten und forschungsethischen Herausforderungen konfrontiert. Der Ständige Ausschuss für Forschungsdaten und Forschungsethik (StAForsch) der DGEKW bearbeitet regelmäßig zentrale Entwicklungen in diesem Bereich und versteht sich als ein Forum zur Verständigung nach innen sowie zur Vertretung entsprechender Positionen nach außen. Der vorgeschlagene Workshop richtet sich an alle, die sich in ihrem Forschungs- und Lehralltag mit solchen Fragen auseinandersetzen oder künftig beschäftigen möchten und soll einen Austausch fortsetzen, der mit großem Interesse beim DGEKWKongress in Dortmund 2023 begonnen wurde. Im Rahmen eines World Café-Formats wollen wir zwei Themen vertiefend nachgehen, für die es aktuell besonders großen Diskussionsbedarf gibt: (1) Fragen der Forschungsethik und der Begutachtung von Anträgen durch Ethikkommissionen sowie (2) der Einsatz von KI in der Lehre. (1) Die AG Forschungsethik im Ständigen Ausschuss dokumentiert die aktuellen Debatten und Diskurse über die ethischen Herausforderungen des ethnografischen (aber auch des historischen) Arbeitens und begleitet sie kritisch. Ein zentrales Anliegen ist die Erarbeitung eines Positionspapiers (analog zu den Statements der ethnologischen und soziologischen Fachgesellschaften und auch transdisziplinären Wissenschaftsverbänden wie der Association of Internet Researchers), welches die Standpunkte und Prinzipien der DGEKW zu diesem Themenkomplex zusammenfasst und geeignet ist, das Verfassen von Ethikanträgen sowie institutionelle Ethikkommissionen bei der Begutachtung von Anträgen aus dem Fach zu unterstützen. Um das Spektrum der aktuellen Debatten zur Forschungsethik im Fach zu erfassen und unterschiedliche Perspektiven möglichst breit einzubeziehen, möchten wir ein partizipatives Verfahren initiieren, das helfen soll zu klären, mit welchen forschungsethischen Problemen sich Forscher:innen aktuell auseinandersetzen und ggf. auch welche Lösungen aus welchen Gründen und in welchen Forschungszusammenhängen probat erscheinen. Nach einer Sammlung von Erfahrungsberichten (vorab via kv-Liste) möchten wir mit dem Workshop ein Forum anbieten, das auf der Basis der Einsendungen erste Befunde diskutiert und zu weiterem Austausch einlädt. (2) KI-basierte Anwendungen wie ChatGPT werden aktuell nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern mit großer Dynamik auch an den Universitäten im Hinblick auf ihre Potentiale und Risiken diskutiert sowie Maßnahmen zum Umgang damit insbesondere in der Lehre verhandelt. Seit dem letzten Workshop im Oktober 2023 haben Institute weitere Erfahrungen mit KI in der Lehre und in Prüfungsformaten gesammelt. Zudem ist generative KI längst nicht mehr „nur“ in ChatGPT als Anwendung zu finden, sondern wird mehr und mehr in digitale Werkzeuge integriert, die von Forscher*innen und Student*innen in ihrem universitären Alltag genutzt werden (können). Der Workshop lädt daher zum weiteren Austausch und zur Systematisierung von Erfahrungen ein. Er zielt auf die Identifikation von Best Practice-Beispielen in Bezug auf neue Wissens- und Lehrformen, Bewertungskriterien und Prüfungsformen aus dem Fach und soll Möglichkeiten eruieren, hierzu im kontinuierlichen Gespräch zu bleiben.
16-18 Uhr Keynote I
- Prof. Dr. Thomas Zwick (Würzburg)
Raum: Hörsaal 2
19 Uhr Abendveranstaltung
Treffpunk: 18.45 Uhr am Frankoniabrunnen
(nur für beitragszahlende Teilnehmer*innen)
Donnerstag, 10.10.2024
10-12 Uhr
- Dr. Inga Wilke (Freiburg)
- Dr. Karin Bürkert (Tübingen)
Raum: Übungsraum 16
Welche neuen Formen des berufs-/praxisorientierten Promovierens gibt es in der Empirischen Kulturwissenschaft? Im Diskussionsforum wollen wir Vorhaben zusammenbringen, die über Institutionengrenzen hinweg alternative Qualifikationsformate testen und diese strukturell verankern wollen. Ein Fokus liegt dabei auf den Erfahrungen, die Promovierende, Volontär*innen, Betreuende, Ausbilder*innen, kooperierende Institutionen und Koordinator*innen in diesem Bereich gesammelt haben. Unser Interesse an diesem Thema entspringt der Zusammenarbeit im Strukturverbund „KulturWissen vernetzt“ (gefördert von der VolkswagenStiftung, 2021-2027), in dem wir Promotionsvolontariate als ein Modul der strukturellen Vernetzung zwischen Museen, Universitäten und Sammlungsinstitutionen erproben. Es handelt sich dabei um ein doppeltes Ausbildungsformat: Die Promotionsvolontär*innen absolvieren ein zweijähriges Volontariat und damit eine Ausbildung in verschiedenen Bereichen eines Museums (Landesmuseum Württemberg oder Badisches Landesmuseum). Anschließend forschen sie zwei Jahre an einer Universität (Tübingen oder Freiburg), verfassen eine Dissertation und sind damit auch für eine wissenschaftliche Laufbahn qualifiziert. Während der gesamten vier Jahre wird ein steter wechselseitiger Austausch zwischen Museum und Universität für die Promovierenden in ihrem Arbeitsalltag gewährleistet. Die so ausgebildeten neuen Mitarbeitenden sind damit erstens hochqualifiziert für verschiedene Arbeitsfelder, und zweitens können sie eine wichtige Vermittlungsfunktion zwischen den Institutionen Hochschule und Museum übernehmen. Wir möchten das Diskussionsforum für unterschiedliche alternative Qualifizierungsformate öffnen und dazu einladen, Beispiele aus verschiedenen Formaten und Kooperationen mit unterschiedlichen Institutionen einzubringen. Folgende Fragen können den Austausch anleiten: • Welche neuen, berufsorientierteren Formen des Promovierens mit Praxisbezug wurden bereits ausprobiert? • Wie können institutionenübergreifende Kooperationen für die Ausbildung über einzelne projektbasierte Qualifikationen hinaus produktiv gemacht werden? • Wie kann die strukturelle Verankerung solcher neuen Formate gelingen? • Welche Herausforderungen bringen diese Formate mit sich, sowohl strukturell (z. B. Finanzierung, Institutionenwechsel) als auch für die Beteiligten in ihren verschiedenen Rollen (z. B. Zeitkonflikte, Zuständigkeiten)? • Welche anderen Formate neben der ‚klassischen‘ Dissertation wurden eventuell bereits erprobt oder sind denkbar? Warum könnte das sinnvoll sein? • Inwiefern verbessern neue Promotionsformate die Möglichkeiten gesellschaftlicher, medialer und beruflicher Teilhabe während der Promotion und darüber hinaus? • Wie können alternative Qualifizierungsformate zu einer zukünftigen Ausrichtung des Faches im Hinblick auf die Mitgestaltung gesellschaftlicher Entwicklungen beitragen? Wir wollen eine Vernetzung herstellen und uns über Beispiele aus der Praxis oder auch Erfahrungen mit gescheiterten Vorhaben austauschen. Ziel ist es, voneinander zu lernen und uns gegenseitig zu ermutigen Neues auszuprobieren. So können bestehende Formate durch den Wissens- und Erfahrungsaustausch in enger Vernetzung mit Museen, außeruniversitären Forschungsinstituten etc. reflektiert und gestärkt werden.
Kontaktieren Sie uns/kontaktiert die Workshopleiter:innen bitte im Voraus per Mail an Inga Wilke (inga.wilke@ekw.uni-freiburg.de) oder Karin Bürkert (karin.buerkert@uni-tuebingen.de) , damit wir Ihre/Eure individuellen Bedürfnisse und Promotionsmodelle im Workshop berücksichtigen können.
- Prof. Dr. Sabine Hess (Göttingen)
- Ass.-Prof. PD Dr. Marion Näser-Lather (Innsbruck)
- Prof. Dr. Ove Sutter (Bonn)
- Lisbeth Brandt (Kiel)
- Prof. Dr. Sophie Elpers (Amsterdam)
- Prof. Dr. Gertraud Koch (Hamburg)
- Kristin Küter (Scicomm-Support)
Raum: Übungsraum 9
Wissenschaft in Tradition der Kritischen Theorie, die zu Themen gesellschaftlicher Diskriminierung von Minderheiten, zu Rassismus, Sexismus und sozialer Ungleichheit forscht und sich für soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung innerhalb und außerhalb der Hochschulen einsetzt, gerät im Zuge des gesellschaftlichen Rechtsrucks in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern innerhalb und außerhalb Europas zunehmend unter Druck. Rechte und autoritäre Angriffe in Form von Shitstorms mit Morddrohungen und Beleidigungen oder auch juristische Klagen betreffen zunehmend auch Wissenschaftler*innen der Empirischen Kulturwissenschaft und Europäischen Ethnologie, z.B. in Bereichen der feministischen, der antirassistischen oder auch der Migrationsforschung. Der Roundtable möchte ein Forum für Austausch sowie einen Diskussionsraum schaffen, um uns über diesbezügliche Erfahrungen, insbesondere aber auch über (insbesondere kollektive) Strategien und Ressourcen auszutauschen, die es braucht, um rechte Angriffe abzuwehren und die Möglichkeit kritischer Forschung, die sich in gesellschaftliche Debatten einmischt, zu erhalten. Auf eine Podiumsdiskussion soll eine Diskussion im Plenum zu aktuellen Problemen und Strategien im Umgang mit Angriffen gegen Wissenschaftler*innen folgen. Der Roundtable greift Diskussionen des DFG-Netzwerks „Public Anthropology“ unter der Leitung von Hansjörg Dilger und Gisela Welz auf, in dem Sozial- und Kulturanthropolog*innen und Europäische Ethnolog*innen sich über aktuelle Fragen kollaborativer, engagierter und öffentlich vermittelnder Anthropologie austauschen.
12-13 Uhr
Raum: Übungsraum 8
14-16 Uhr
- Matthias Harbeck (Berlin)
- Dr. Sabine Imeri (Berlin)
Raum: Übungsraum 16
- Dr. Olga Reznikova (Innsbruck)
- Laura Bäumel, M.A. (Zürich)
Raum: Übungsraum 9
Mit diesem Input-Vortrag möchten wir die Auseinandersetzung mit der aktuellen Herausforderung der Studierendenzahlen an fast allen Standorten des Faches von der Seite des Selbstverständnisses des Faches angehen. An vielen Universitäten wählen Abiturient_innen zunehmend Psychologie statt EKW/EE. Aber was ist das für ein Fach, für das wir junge Menschen zu begeistern versuchen, die während der Corona-Pandemie, während des Krieges in der Ukraine und im Nahen Osten und während des Erstarkens völkisch nationalistischer Bewegungen und Parteien zur Schule gegangen sind? Während die Psychologie nach den individuellen Strategien und dem Umgang der Menschen mit den Krisen sucht und damit ihren Teil der Antwort auf die Frage nach dem Leiden in der Gesellschaft gibt, schließen wir an Dieter Kramers Frage aus den 1970er Jahren an: Was nützt die Volkskunde? Wir sind davon überzeugt, dass die Diskussion um die Aufgabe der wissenschaftlichen Gesellschaftskritik und das Selbstverständnis des Faches sowie die damit verbundene notwendige Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Nutzen der Psychologie (und anderen „helfenden“, auf das Individuum fokussierten, Fächern) für die Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Wir gehen davon aus, dass die zentrale Frage ist, welche Rolle wir der Post-Volkskunde bei der Benennung, Analyse und Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme und Krisen zuschreiben. Eine Möglichkeit wäre zurück zur Frage von Werturteilen und Totalität der Gesellschaft zu kehren, die die Krise aus ideologie- und gesellschaftskritischer Perspektive bearbeitet.
- Prof. Dr. Gertraud Koch (Hamburg)
Raum: Übungsraum 22
16-18 Uhr Keynote II
- Dr. Cornelia Kühn (Potsdam)
Raum: Hörsaal 2
Transdisziplinarität als neuer Forschungsmodus einer nachhaltigen Wissenschaft wird in verschiedenen Bereichen zunehmend relevanter: Zum einen sind Fördermittel an die gesellschaftliche Relevanz und den nachhaltigen Wissenstransfer in die Gesellschaft gebunden (z.B. Bekanntmachung - BMBF). Auch bei Exzellenzkriterien für Universitäten, Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen wird der Wirkungsfaktor auf gesellschaftliche Bereiche als „Third Mission“ (neben Forschung und Lehre) zunehmend höher bewertet (Research Excellence Framework 2014: Impact = 20 %; REF 2021: Impact = 25 %). Zum anderen gilt die „Große Transformation“ hin zu einer nachhaltigen Entwicklung mittlerweile als die globale gesellschaftliche Herausforderung, wobei die tiefgreifenden Veränderungsprozessen auch die Wissenschaft und das Wissenschaftssystem betreffen. Bei dem Prinzip „Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung“ wird Transdisziplinarität daher als eines von acht Kriterien für die zukünftige Forschung benannt (LeNa Nachhaltig forschen (nachhaltig-forschen.de)). Transdisziplinarität bedeutet dabei nicht eine Auflösung von disziplinärem Wissen oder das Zusammenschmelzen verschiedener Theorien. Im transdisziplinären Forschungsprozess werden die je unterschiedlich gewonnenen Teilerkenntnisse problembezogen und methodengeleitet integriert, um Wirkungen und Lösungen für ein gesellschaftliches Problem zu erreichen. Dafür wird im Laufe des Forschungsprojektes sowohl das disziplinäre und das interdisziplinäre Wissen als auch das (Erfahrungs-)Wissen von Praxispartner*innen systematisch aufbereitet, methodengeleitet reflektiert und iterativ in den Forschungsprozess wieder eingespeist (= transdisziplinäre Wissensintegration). Zum Gelingen transdisziplinärer Forschungen benötigt es daher neben den disziplinären Methoden der analytischen Forschung auch Methoden zur Wissensintegration wie Prozessgestaltung oder Moderation als wichtigen sozialen und kommunikativen Rahmen für die notwendige Wissensintegration. Das normative Ziel ist dabei einerseits, sozial robuste, akzeptierte und umsetzbare Ergebnisse zu erarbeiten, die zur Lösung komplexer gesellschaftlicher Probleme beitragen. Andererseits entstehen aber auch neue wissenschaftlichen Erkenntnisse, neue Forschungsimpulse und eine gesteigerte Reflexivität durch den transdisziplinären Forschungsprozess. Während es bereits gut erprobte Methoden und Formate für die Förderung von gesellschaftlichen Wirkungen in unterschiedlichen transdisziplinären Forschungskontexten gibt, steht die Entwicklung von Qualitätskriterien für transdisziplinäres Forschen und Arbeiten noch am Anfang. Auch die Ausbildung von „Wissensintegrationsexpert*innen“ und „Wissenskulturvermittler*innen“ in transdisziplinären Kompetenzzentren gibt es bislang kaum (td-acadamy: Home | tdAcademy (td-academy.org), ISOE: Institut für sozial-ökologische Forschung: ISOE und td net: Network for Transdisciplinary Research | td-net (transdisciplinarity.ch)). In dem Beitrag werden die Methoden und Kompetenzen für transdisziplinäres Arbeiten dargelegt und nach Überschneidungen mit ethnografischen Kompetenzen der Beobachtung und Auswertung gefragt. Damit können einerseits Möglichkeiten für neue Berufsfelder für Absolvent*innen in den Blick genommen werden. Andererseits soll in dem Beitrag auch auf die Risiken von Transdisziplinarität als einer „angewandten Wissenschaft“ innerhalb unseres aktuellen Wissenschaftssystems Bezug genommen werden, die bislang eher als „reine“ Unterstützung für die Vermittlung von (vorrangig naturwissenschaftlich-technischem) disziplinärem Fachwissen wahrgenommen wird und nicht überall als „richtige“ Forschung gilt. Entsprechend fließt die Kompetenz in transdisziplinären Forschungsprozessen auch nicht in die Bewertungskriterien z.B. bei Berufungen oder als Exzellenznachweis ein.
Freitag, 11.10.2024
9-12 Uhr
- Dr. Dennis Eckhardt (Berlin)
- Jun.-Prof. Dr. Simone Egger (Saarbrücken)
- Dr. Sarah May (Freiburg)
- Dr. Nadine Wagener-Böck (Kiel)
Raum: Übungsraum 22
Die Gegenwart ist geprägt von einschneidenden Veränderungen und mitunter fast unüberbrückbar erscheinenden Kontroversen. Als Feld und Gegenstand der Analyse lässt sich Arbeit dabei als Schlüsselthema begreifen. Zum einen verändern sich Modi des Arbeitens, zum Beispiel durch Effekte der Klimakrise, durch Fachkräftemangel oder Digitalisierung. Zum anderen sind Arbeitsalltage nicht zuletzt in der Wissenschaft mit einschneidenden Herausforderungen konfrontiert, denen es langfristig zu begegnen gilt. Im Rahmen des Panels geht es um die Trias „Arbeitskulturen – Ko-laboration – Public Anthropology“: Wir wollen selbstreflexiv ausloten, welche Möglichkeiten sich gerade aus einer arbeitsethnografischen Perspektive bieten, um die spätmoderne Welt im Wandel und ihre brennenden Themen zu erschließen. Die Bandbreite an aktuellen Auseinandersetzungen reicht von der Verlagerung von Arbeit, sichtbar am Beispiel von Leerständen in Innenstädten über den grünen Umbau von Industrien bis hin zum politisch viel diskutierten Zugang zu Arbeit für Menschen mit Flucht- und/oder Migrationsbiografie. Welche Rolle kann eine kritisch-kulturwissenschaftliche Erforschung in diesen Zusammenhängen spielen? Welche neuen Formen der Kooperation und Kommunikation werden hier möglich und nötig? Gleichzeitig stellen sich Aufforderungen und Anforderungen an Wissenschaftler*innen neu, damit verbunden ist auch die Frage, wie von unserer Seite damit umgegangen wird. Wohin sollen oder müssen wir uns als Lehrende und Forschende bewegen? Welche Strategien sind zu entwickeln, wenn Wissen vor allem auf Plattformen geteilt und in sozialen Medien ausgehandelt wird? Wohin und auf welche Weise lässt sich die Universität öffnen und vernetzen? Wo können wir sichtbar(er) werden und zum Verständnis von komplexen Entwicklungen beitragen? Welche Möglichkeiten der Kooperation mit diversen Partner*innen ergeben sich – etwa in Gestalt einer „Ko-laboration“? Welche Herausforderungen sind damit verbunden? Mit wem wollen wir zusammenarbeiten – mit wem nicht –, und wann genau erkennen und begründen wir das wie? 2 Als Format schlagen wir ein Panel vor, das zunächst von vier Impulsen (5-10 min) und einer offenen Diskussionsrunde ausgeht. Die Inputs sollen zeigen, wo und wie Arbeitsethnografie konkret wirksam werden kann: ko-laborativ im Bereich der Zusammenarbeit mit der Informatik (Dennis Eckhardt), im Kontext von Stadtforschung, Museumsarbeit und öffentlichen Debatten (Simone Egger), in der Landwirtschaft und Public Anthropology (Sarah May) oder auch im Bereich der wissenschaftlichen Arbeit an Arbeit (Nadine Wagener-Böck/studio lab). Gemeinschaftlich wollen wir mit den weiteren Teilnehmenden des Workshops vertiefen, wo wir stehen und wie sich die Arbeitsethnografie künftig in ihrer Pluralität verorten kann. Aus dem Arbeitstreffen der Kommission Arbeitskulturen in Saarbrücken, das der Tagung in Würzburg unmittelbar vorausgeht, werden ebenfalls Diskussionspunkte einfließen.
- Prof. Dr. Katharina Eisch-Angus (Graz)
- Dr. Gesa Ingendahl (Tübingen, für den Ständigen Ausschuss für Studium und Lehre der DGEKW)
- Ass.-Prof. PD Dr. Marion Näser-Lather (Innsbruck)
- Prof. Dr. Lioba Keller-Drescher (Münster)
Raum: Übungsraum 9
Seit einigen Jahren sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowohl sinkende Studierendenzahlen für EKW/EE Studiengänge als auch zunehmende Nachwuchsprobleme im Prä- und Postdocbereich an universitären Instituten sowie an Museen zu beobachten, auf deren Stellen sich zu wenig Absolvent:innen aus den EKW-EE-Fachzusammenhängen bewerben. Der Workshop möchte an bisherige Initiativen des Ständigen Ausschuss für Studium und Lehre der DGEKW (u.a. der Internetseite „Kultur studieren“ und der LV zu Berufsfeldern) anknüpfen und einen länderübergreifenden Austausch anregen, um die aktuellen Erfahrungen von Instituten und außeruniversitären Institutionen zu sammeln und gemeinsam darüber nachzudenken, wie vorhandenes Wissen und lokale Ressourcen gebündelt und Synergieeffekte genutzt werden könnten. Ideen und neue Perspektiven sind immer wieder neu zu wenden und zu denken. So könnte z.B. überlegt werden, ein koordiniertes, langfristiges, d.h. in Anbetracht der vorhandenen finanziellen, personellen und infrastrukturellen Ressourcen nachhaltig umsetzbares Projekt zu entwickeln, um das Fach und seine Relevanz ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Eine solche Kampagne könnte beispielsweise eine DACH-weite Zielgruppenanalyse hinsichtlich potentieller (BA- wie MA-)Studierender, eine Measurement of Effectiveness-Analyse bisheriger Initiativen und ergänzende zukünftige Maßnahmen beinhalten. Wie sind die Studierenden überhaupt zu unserem Fach gekommen? Welches sind ihre Bedürfnisse/Wünsche etc., im Hinblick auf Inhalte, aber auch Berufsbilder? Wie erreicht man sie am besten, auf welche Keyleader/Akteur:innen muss man zusätzlich einwirken, um die Attraktivität unseres Faches herauszustellen (Medien, Politik, spezifische Teilöffentlichkeiten)? Wie kann man Institute bei der Studiengangswerbung stärken/unterstützen? Wie lassen sich durch projekt- und praxisorientierte Lehre potentielle Studierende wirkungsvoll ansprechen? Auf der Basis der Ergebnisse kann eine neue übergreifende Kampagne entwickelt werden. Im vierstündigen Workshop, der gemeinsam mit dem Ständigen Ausschuss für Studium und Lehre in der DGEKW durchgeführt wird, sollen zunächst bisherige Initiativen und Ideen des Ständigen Ausschusses und unter anderem des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck vorgestellt werden. Im Anschluss sollen Bedarfe und Ideen zur Nachwuchswerbung, beispielsweise für eine länderübergreifende Kampagne und zukünftige Kooperationsmöglichkeiten, gesammelt und diskutiert werden.
10-12 Uhr
- Dr. Milena Kriegsmann-Rabe (Bonn)
- Dr. Victoria Huszka (Bonn)
Raum: Übungsraum 18
Kultur ist zentraler Untersuchungsgegenstand unseres Faches. In den letzten Jahrzehnten ist Kultur aber auch als Oberbegriff für weiche Standortfaktoren zu einem festen Bestandteil der Regionalentwicklung ländlicher Räume geworden. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der jüngsten Neuausrichtung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), das kulturelle Aktivitäten in ländlichen Regionen als „Faktor für Resilienz und Befähigung zum Umgang mit Transformationsprozessen“ (Kegler 2021) erachtet und deshalb die Förderung von Kunst, Kultur sowie deren Untersuchung zu einem zentralen Aufgabengebiet ausgebaut hat.
Davon zeugen auch die in 2023 angelaufenen 22 Projekte im Forschungsverbund „Faktor K – Forschung zum Faktor Kultur in ländlichen Räumen“, an dem zahlreiche empirisch-kulturwissenschaftliche Forscher:innen (fünf empirisch-kulturwissenschaftliche Institute und weitere Fachkolleg:innen an disziplinär anders ausgerichteten Instituten) beteiligt sind. Diese Projekte bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen politischer Auftragsforschung, eigenen Ansprüchen an fachlich fundierte Grundlagenforschung und den Schwierigkeiten eines Feldes von oftmals prekärer Kunst- und Kulturarbeit, die häufig auf Ehrenamt und damit zivilgesellschaftlichen Ressourcen basiert. Die Expertise der Empirischen Kulturwissenschaft (im Bereich der Ländlichkeitsforschung und auch im Bereich ethnografischer Methoden) wurde zwar explizit in der Ausschreibung des BMEL adressiert; doch zugleich sind die Kulturverständnisse und Vorstellungen von Ethnografie innerhalb des Forschungsverbundes und der gesteckten Rahmenbedingungen seitens des Fördergebers äußerst divers. In dieser spezifischen Konstellation gibt es Vorteile, aber auch Herausforderungen und Risiken, denen wir bestenfalls als Fachvertreter:innen geschlossen begegnen möchten: Wie vereinbar sind unsere Ansprüche an empirisch-kulturwissenschaftliche Forschung mit den Zielen unserer Fördergeber? Wie können wir mit normativen Setzungen (zum Kulturbegriff oder zur Rolle von Kulturarbeit, Ländlichkeit o.ä.) umgehen? Wo bleibt Raum, um Kritik an politischen Annahmen und Beurteilungen von Kultur zu üben? Wen können oder sollten wir mit dem in unseren Projekten generierten Wissen jenseits unserer Fördergeber adressieren? Welchen „Impact“ können wir realistischerweise aus einer solchen Position heraus anstreben? Zu unserer Diskussion laden wir neben den Kolleg:innen des Forschungsverbundes alle Interessierten ein, die mit ähnlichen Fragen der politischen oder fördergeberischen Adressierung von Kultur (in verschiedensten Deutungen) zu tun haben.
- Matthias Harbeck (Berlin)
- Dr. Sabine Imeri (Berlin)
Raum: Übungsraum 16
Die Empirische Kulturwissenschaft ist – wie andere Disziplinen auch – derzeit massiv durch die Digitalisierung der Forschungspraxis bei gleichzeitigem Ressourcenmangel geprägt: Forschung wurde um digitale Optionen bei der Recherche und beim Publizieren erweitert, digitale Materialien und Datenmengen lassen sich zum Teil nur noch mit digitalen Instrumenten bearbeiten und digitale Kommunikation ermöglicht und erzeugt neue Formen der Kollaboration im Forschungsprozess, die im Wesentlichen auf cloud- oder internetbasierte Arbeits- und Austauschsplattformen angewiesen sind. Wissenschaftspolitik und -ökonomie (er)fordern darüber hinaus nachhaltigere Infrastrukturen und Prozesse, viele kleine kurzlebige Insellösungen und als intransparent angesehene Datenerhebungen werden, oft unter Verweis auf mangelnde Effizienz, zumindest mittelfristig nicht mehr als förderfähig betrachtet. Zudem ist Offenheit das Gebot der Stunde: Ergebnisse vor allem aus Drittmittelforschung sollen möglichst umfassend und möglichst barrierefrei nicht nur für weitere Forschung, sondern für die Gesellschaft insgesamt zugänglicher und nutzbar gemacht werden. Als zentrales Leitbild wird hier Open Source, Open Access, Open Research Data – kurzum Open Science propagiert.
Dieser Prozess ist insgesamt nicht neu und auch die EKW hat ihn – in der Praxis und der Debatte – längst angenommen: Es gibt eine große Bereitschaft, im Open Access zu publizieren, Forschungsdatenarchivierung und -nachnutzung werden diskutiert und allmählich auch praktiziert, digitale Instrumente werden zur Transkription, Codierung und Annotation verstärkt eingesetzt und Möglichkeiten der sinnvollen Erweiterung des Methodenspektrums um maschinelle Analyseschritte insbesondere aus den Digital Humanities diskutiert. Gleichzeitig sind die dafür notwendigen technischen Infrastrukturen mit Blick auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen insbesondere der ethnografischen Forschung häufig nur bedingt geeignet. Generische Infrastrukturen und Arbeitsumgebungen, wie sie Universitäten in der Regel zur Verfügung stellen (müssen), benötigen Anpassungen, die aber – etwa wenn sensible, personenbezogene Materialien und Forschungsdaten kollaborativ bearbeitet oder archiviert werden sollen – kaum angemessen geleistet werden können. Gerade für ein mehr oder weniger „kleines Fach“ wie die EKW – insgesamt und an den Standorten – kann der Aufbau geeigneter Infrastrukturen, aber auch die Versorgung mit oft hochpreisiger Literatur und fachspezifischen Datenbanken oder die Retrodigitalisierung (historischer) Fachliteratur lokal personell und finanziell nicht immer geleistet werden. Mit Blick auf die Kosten, die Arbeitsaufwände und die notwendige Professionalisierung ist es auch nicht immer sinnvoll, an den einzelnen Standorten je eigene Entwicklungsarbeit Gang zu setzen. Ähnlich können die notwendige Reflexion unterschiedlicher Aspekte von Open Science, die Diskussion möglicher Implikationen für die Forschungspraxis sowie Positionsfindungen auch im Rahmen der Fachgesellschaft nicht immer aus eigenen Ressourcen organisiert und moderiert werden.
Eine Möglichkeit, diesem Ressourcenmangel zu begegnen, ist die Bündelung der Kräfte im Fach – mit dem Fachinformationsdienst Sozial- und Kulturanthropologie (FID SKA) als Partner, der mit seinem Fokus auf die ethnologischen Fächer standortübergreifend Services fachlich orientiert und abgestimmt entwickelt, mit seiner Expertise und Vernetzung in der Infrastrukturlandschaft fachlich zugeschnittene Projektberatung anbietet und Projekte organisatorisch wie logistisch unterstützen kann. Die Arbeiten reichen von der überregionalen Bereitstellung digitaler Lizenzen für Literatur und Datenbanken über die Entwicklung angemessener Verfahren und Strukturen für die Archivierung und Nachnutzung sensiblen ethnografischen Materials sowie die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen bis hin zu Diskussionsbeiträgen etwa zu den ethischen Implikationen von Open Science und Open Access.
Der Impulsvortrag stellt den Fachinformationsdienst Sozial- und Kulturanthropologie und seine Services vor und zeigt, welche Kräfte hier wie gebündelt werden können und welche Ressourcen zur Verfügung stehen – und was derzeit auch noch nicht geleistet werden kann. Er soll damit auch einen Ausblick auf die (hoffentlich) kommende vierte Förderphase 2025- 2027 bieten und einen Austausch über weitere Bedarfe der EKW an der Schnittstelle von Infrastruktur und ethnologischer Forschung in Gang bringen.
12.15 Uhr
Verabschiedung durch den Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Empirische Kulturwissenschaft, Würzburg
Raum: Hörsaal 2
Sponsored by lh and sigikid
![]()
![]()